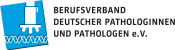Neugier nach den Ursachen einer Erkrankung
Dr. med. Edward Michaelis

Was denken Sie – warum hat sich das Fach Pathologie überhaupt entwickelt?
Michaelis: Ich möchte es paradoxerweise mit einer Frage beantworten: Gibt es etwas Menschlicheres als unstillbare Neugierde? Ständiges Hinterfragen und die Suche nach der Wahrheit treiben uns alle an und sind Grundgedanken jeglicher Wissenschaft. Jeder von uns hat sich sicherlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich im Körper vor sich geht, wenn er krank wird. Und wenn man sich dann noch die Frage stellt: Wo findet in unserem Körper die Krankheit statt?
, dann sind wir bei der Pathologie. Dank dieser Neugier
hat sich letztlich unser Fachgebiet entwickelt. Rudolf Virchow, der Vater der modernen Pathologie im 20. Jahrhundert, war es, der seine Suche nach dem Krankheitsort einmal mit dem Satz „Ubi est morbus?“ (Lateinisch für: Wo ist die Krankheit?
) treffend zusammenfasste. Und Virchow selbst hat dabei die entscheidende Antwort geleistet. Er erkannte mithilfe des Mikroskops, dass unser Organismus wie ein Abbild unserer Gesellschaft auf dem fein abgestimmten Zusammenspiel unserer Zellen beruht. Heute können wir dank Jahrzehnten kontinuierlicher Forschung Krankheit nicht nur indirekt umschreiben, sondern ein Bild vom Gewebe der erkrankten PatientInnen zeigen und daran erkennen, um welche Erkrankung es sich handelt. Ein Bild sagt in diesem Fall tatsächlich mehr als tausend Worte.
Wie kamen Sie persönlich zur Pathologie? Welche Neugier hat Sie getrieben?
Michaelis: Wie viele meiner KollegInnen habe ich selbst erst über Umwege zur Pathologie gefunden. Im Medizinstudium hat mich Krebs schon immer fasziniert. Passend zu diesem Interesse war meine erste Station nach dem Studium eine Anstellung als Assistenzarzt in der Onkologie. Obwohl ich die Arbeit mit den PatientInnen sehr bereichernd und berührend fand, bin ich dort nie wirklich angekommen. Im Alltag blieb immer die Frage, was denn nun wirklich in den PatientInnen vor sich geht. Mich trieb also auch die Frage um, wo denn genau die Krankheit stattfindet und wie man sich das bildlich vorstellen kann. So gelangte ich nach einem Jahr im Krankenhaus in die Pathologie. Hier lerne ich seit fünf Jahren meinen Blick für die Störungen im fragilen Gleichgewicht unseres Zellenstaates zu schärfen.
Wie kann man sich Ihre Arbeit im Alltag konkret vorstellen?
Michaelis: Wir erhalten in unserem Institut täglich Hunderte von Gewebeproben lebender PatientInnen, die teils unter unklaren Symptomen leiden oder bei denen vielleicht auch schon ein konkreter Verdacht einer Erkrankung besteht. Diesen PatientInnen werden kleine Gewebeproben oder größere chirurgische Präparate entnommen und von uns zunächst mit dem bloßen Auge und nach einer aufwendigen chemischen Bearbeitung unter dem Mikroskop angesehen. Gewappnet mit dem gesammelten Wissen aus über 150 Jahren Forschung suchen wir dabei nach charakteristischen Zeichen bestimmter Erkrankungen. Man könnte uns PathologInnen also vereinfacht auch als Mustererkennungsspezialisten beschreiben. Wir schauen uns die Zellen in ihrem geweblichen Gefüge an und versuchen, ihnen ihre Geschichte zu entlocken. Wir erkennen dabei Muster von Erkrankungen wieder, die wir so ähnlich schon bei anderen PatientInnen oder in Lehrbüchern gesehen haben. Damit ermöglichen wir in vielen Fällen erst die korrekte Behandlung durch unsere KollegInnen am Patientenbett oder erlauben ChirurgInnen die Qualität ihrer Arbeit zu überprüfen.
Mit welchen Untersuchungsmethoden arbeiten Sie neben dem Mikroskop?
Michaelis: Neben dem Mikroskop stehen uns inzwischen zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung, die durch die fortwährende Suche nach einem noch besseren Verständnis von Krankheitsprozessen entwickelt wurden. So können wir beispielsweise mithilfe von künstlich hergestellten Antikörpern, die in ihrer natürlichen Form von unserem Immunsystem zur Erkennung von körperfremden Erregern gedacht sind, ganz bestimmte Moleküle innerhalb der Zellen nachweisen. Dies erlaubt uns, Zellen, die unter dem Mikroskop sonst identisch aussehen, auseinanderzuhalten. So kann zum Beispiel eine Krebsansiedelung (Metastase) in einem Organ dem Ursprungsort zugeordnet werden.
Des Weiteren ergeben sich aus der Gentechnik ganz neue Möglichkeiten der Diagnostik. Durch die Entschlüsselung des genetischen Codes von vielen verschiedenen Krebserkrankungen unterschiedlicher PatientInnen haben wir inzwischen verstanden, wie individuell der Krebs eines einzelnen Patienten sein kann. So können wir nicht nur präzisere Diagnosen stellen, sondern auch mithilfe gentechnischer Analysen die richtigen Medikamente für jeden einzelnen Patienten finden.
Ist die Pathologie für Sie ein Traumjob?
Michaelis: Als PathologInnen vollziehen wir auf gewisse Weise jeden Tag im Kleinen den Prozess, der zur Evolution unseres Faches geführt hat. Wir bearbeiten in steigender Komplexität das Gewebe von PatientInnen, die zu Hause oder im Krankenbett dringend eine Antwort auf die Frage suchen, ob und wo bei ihnen eine Erkrankung vorliegt. Wir versuchen dabei mit größtmöglicher Sicherheit und Präzision, Antworten auf diese Fragen zu geben. Liegt überhaupt eine Erkrankung vor, die behandelt werden muss? Wenn ja, welche Erkrankung ist es genau? Wenn es sich um eine bösartige Erkrankung handelt, wie ist die Prognose? Und mit welchen Medikamenten können unsere klinischen KollegInnen ihnen am besten helfen? Für mich persönlich bedeutet die Suche nach Antworten auf diese Fragen, jeden Tag meine Neugier auszuleben und auf meine Art für PatientInnen da zu sein. Daher kann ich sagen, dass mich dieser Beruf erfüllt.
Wie läuft die Facharztausbildung ab?
Michaelis: Ähnlich wie in den klinischen Fächern darf man sich die Facharztausbildung nicht so wie die Schule oder das Studium vorstellen. Der Schwerpunkt liegt definitiv bereits auf dem eigenständigen Arbeiten. Das bedeutet, man ist fest im Arbeitsalltag integriert und es gibt kein detailliertes, strukturiertes Currikulum, das man über die Jahre der Facharztausbildung durchläuft.
Anders als in der Facharztausbildung am Krankenbett werden wir dabei jedoch noch viel länger von erfahrenen KollegInnen betreut. Man kann sich das ein wenig so vorstellen wie bei einer Meister-Lehrlings-Beziehung. Schritt für Schritt werden wir an die verschiedenen Arbeitsbereiche herangeführt. Der weitaus größte Bereich ist dabei die Mikroskopie. Hier kann man bereits nach den ersten Monaten beginnen, selbstständig die Lösung einzelner Fälle zu erarbeiten. Mit dem selbst entwickelten Lösungsansatz geht man dann zur zuständigen Ausbilderin oder zum zuständigen Ausbilder. Dort mikroskopiert man noch einmal das bereits Gesehene und kommt gemeinsam zu einer Diagnose. Das Erlernen des Mikroskopierens gleicht also ein wenig dem Lernen eines Handwerks. Untermauert wird dies jedoch von viel klassischem Buchwissen, das man sich in selbstständiger Büroarbeit aneignen muss.
Welche Fähigkeiten sind Ihrer Meinung nach für die Pathologie wichtig?
Michaelis: Zunächst möchte ich mit dem Klischee aufräumen, dass über die Pathologie in der Medizin im Allgemeinen vorherrscht. Da wir keinen direkten Patientenkontakt haben, werden wir oft als eigentümliche Eigenbrötler gesehen, die den ganzen Tag im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeiten. Es ist schon richtig, dass man für die Pathologie eine gewisse nerdige
Faszination für das Arbeiten mit dem Mikroskop mitbringen sollte. Dies vorausgesetzt, tummeln sich jedoch in diesem Fach die unterschiedlichsten Charaktere. Dabei spielt die Fähigkeit, mit KollegInnen im eigenen Fach und in der Klinik zu kommunizieren, eine immer größere Rolle. Die zunehmende Komplexität der Behandlung vieler Krebserkrankungen macht uns PathologInnen zunehmend zu wichtigen Beratern in einem multidisziplinären Team.
Braucht man eine Promotion für die Pathologie?
Michaelis: Die Promotion in der Medizin ist ja vollkommen unabhängig von der Approbation und damit der Erlaubnis, den Beruf auszuüben. Meiner Meinung nach ist eine Promotion ein nettes Extra, was einem möglicherweise hilft, eine universitäre Karriere zu beginnen. Für eine fundierte Ausbildung in der Pathologie ist es jedoch nicht zwingend notwendig.
Wie sind die Aussichten nach der Ausbildung, was kann man danach erwarten?
Michaelis: PathologInnen sind extrem gefragt und werden auch in Zukunft eine immer größere Rolle in der Behandlung von Krebserkrankungen einnehmen. Da wir aufgrund der Altersentwicklung unserer Gesellschaft mit einer deutlichen Zunahme der Krebserkrankungen rechnen, wird auch die Arbeitsleistung der PathologInnen weiter zunehmen. Wer sich für eine Karriere in der Pathologie entscheidet, wird auf absehbare Zeit mit den richtigen Voraussetzungen immer eine Stelle finden.
Ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich, wenn man als PathologIn tätig ist?
Michaelis: Was die Pathologie von vielen anderen Fächern unterscheidet, ist ja der fehlende Patientenkontakt. Das mag für viele klinisch-orientierte KollegInnen eher nachteilig wirken. Für unsere Arbeitsbedingungen hat es aber den definitiven Vorteil „normaler“ Arbeitszeiten. Das bedeutet: keine Wochenendarbeit und auch keine Nachtarbeit. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist damit viel besser möglich als in anderen Fächern.
Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft in der Pathologie aus? Wo geht die Reise hin?
Michaelis: Die Herausforderungen an die Pathologie in den kommenden Jahrzehnten sind ja schon bereits ein wenig angeklungen. Wir werden mit einer eher kleiner werdenden Zahl von PathologInnen immer größere Probenmengen bewältigen müssen. Das heißt, wir werden uns Hilfe suchen müssen. Eine ganz entscheidende Entwicklung, die bereits im Gange ist, kann hoffentlich dazu beitragen, dieses Problem zu lösen. An den Universitäten wird gerade fieberhaft daran geforscht, künstliche Intelligenz das Analysieren von Gewebebildern beizubringen. Ziel dabei ist es, nicht uns PathologInnen zu ersetzen, sondern uns durch die Vorauswahl schwieriger Fälle oder die Lösung der besonders häufigen, offensichtlichen Fälle viel Arbeit abzunehmen.
Wie kann man die Pathologie besser kennenlernen?
Michaelis: Für Studierende gibt es auch in der Pathologie die Möglichkeit, das Fach über eine Famulatur näher kennenzulernen. Wir freuen uns sehr über interessierte Studierende und haben durch unseren weniger stressigen Arbeitsalltag auch häufig die Kapazitäten, viel zu erklären. Um einen ersten Einblick zu bekommen, reicht aber vielleicht schon eine Hospitation von wenigen Tagen im Rahmen einer anderen Famulatur oder eines Praktischen-Jahr-Tertials. Auch wenn man selbst nicht in unserem Fach arbeiten möchte, bekommt man schon ein viel besseres Verständnis für unsere Arbeitsweise. Das erleichtert die spätere Kommunikation unter KollegInnen enorm.
Wer darüber hinaus nicht genug von der Pathologie bekommen kann, dem lege ich die sozialen Netzwerke ans Herz. Sowohl auf X, ehemals also Twitter, als auch auf Instagram gibt es viele engagierte PathologInnen, die tolle Fälle und interessante Bilder aus ihrem Arbeitsalltag teilen.
Was sind besondere Momente in Ihrem Arbeitsalltag?
Michaelis: Auch wenn wir nicht in direktem Kontakt mit unseren PatientInnen stehen, so haben wir dennoch ihre Schicksale im Hinterkopf. So ist es schon etwas Besonderes, wenn man in einem kniffeligen Fall Entwarnung geben kann. Manchmal ist es für unsere klinischen KollegInnen schwer zu erkennen, ob eine sogenannte Raumforderung, also eine unphysiologische Volumenzunahme einer Struktur im Körperinneren, entweder durch eine Entzündung oder einen Krebs entstanden ist. Wenn man dann den Krebsverdacht abwenden kann, ist das schon ein gutes Gefühl.
Gleichzeitig hat unser Beruf aber auch etwas Widersprüchliches. Denn wir wären nicht gut in dem, was wir tun, wenn ein Teil von unserem Gehirn nicht auch an besonderen Fällen Gefallen finden würde. Ein seltener, besonders aggressiver Krebs zum Beispiel kann unter dem Mikroskop einfach besonders interessant aussehen. Natürlich wissen wir, dass es für die Patientin oder den Patienten überhaupt nichts Gutes bedeutet. Aber würden wir nicht auch Befunde übersehen, wenn wir nur danach schauen würden, was wir uns für den Patienten oder die Patientin wünschen? So gibt es im Alltag immer wieder etwas seltsame, aber besondere Momente, in denen man sich zum Beispiel darüber freut, dass die anfängliche Intuition bei einem Fall richtig war, und man eine gute Diagnose gestellt hat, auch wenn man weiß, was es für ein Leid für die Betroffenen bedeutet.